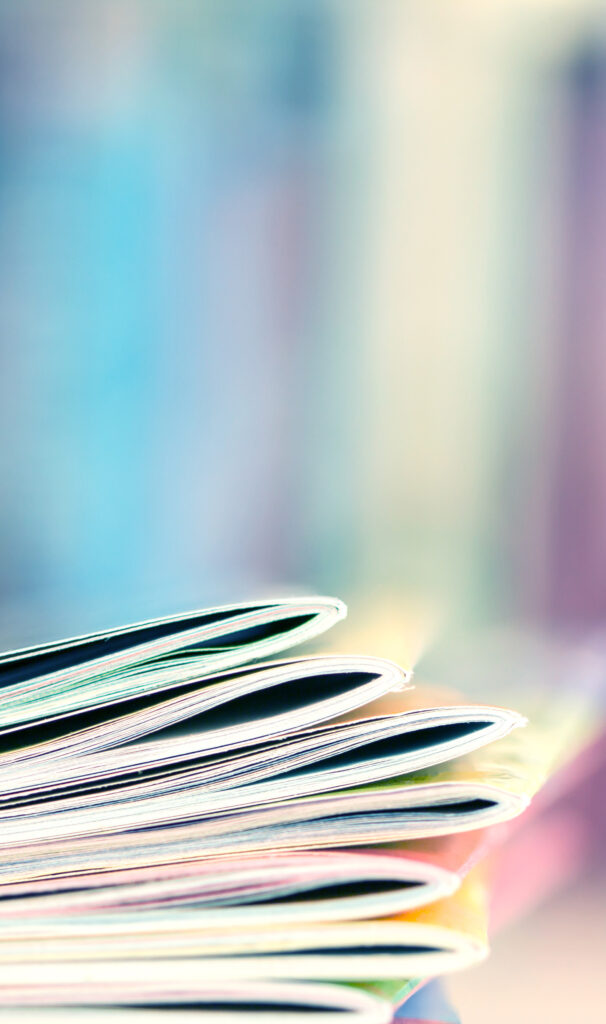Datenbanken entfernen vermehrt Journals aus ihren Indices
Im Jahr 2024 wurden aus dem Directory of Open Access Journals (kurz: DOAJ) 636 Zeitschriften entfernt. Darunter waren 400 mit der folgenden Begründung aus dem Index entfernt worden: „Journal not adhering to best practice“ – also, weil sich die jeweilige Zeitschrift nicht an die allgemein anerkannte Branchenpraxis des wissenschaftlichen Publizierens halte. Allein 17 Zeitschriften waren darunter von einem der publikationsstärksten Verlage überhaupt, dem Open-Access-Verlag MDPI AG. Im März 2023 war bereits die Nachricht durch die wissenschaftliche Presse gewandert, dass eines der Flagship-Journals des Verlags keinen Journal Impact Factor (JIF) mehr erhalten würde. Dieser ist gekoppelt daran, dass die Zeitschrift im sogenannten Science Citation Index im Web of Science geführt wird. In der Folge kam es zu einem Reputationsverlust, der in einem massiven Einbruch der Einreichungs- und Publikationszahlen Ausdruck fand.
Aber was haben diese Ausschlüsse von ganzen Zeitschriften aus den verschiedenen Datenbanken zu bedeuten? Was sind die Hintergründe? Diese möchten wir im Folgenden beleuchten, ebenso wie die Schlüsse, die wir für die Open-Access-Förderung der Universität Leipzig daraus ziehen.
Bibliographische Datenbanken wie das bereits erwähnte Web of Science, aber auch Scopus oder PubMed dienen der Auffindbarkeit und Sichtbarkeit von wissenschaftlichen Informationen, speziell von Zeitschriftenartikeln. Indem sie dabei selektiv in der Auswahl der auszuwertenden Zeitschriften vorgehen, spielen sie automatisch eine Rolle in der Bewertung der Relevanz eben dieser Zeitschriften. Bei der Auswahl sind dabei neben formalen Kriterien immer auch redaktionelle Entscheidungen relevant. Allem voran muss immer gewährleistet sein, dass die in der Zeitschriftenredaktion installierten Mechanismen zur Qualitätssicherung – in der Regel das sogenannte Peer Review – zuverlässig funktionieren. Gleiches gilt für das DOAJ, dessen Ziel nicht so sehr die bibliographische Erschließung der Artikel ist, sondern viel mehr tatsächlich die Qualitätskontrolle auf der Ebene der Zeitschriftentitel.
Was steckt hinter den Datenbank-Ausschlüssen?
Besonders im Fokus der laufenden Debatte stehen sogenannte Special Issues, also thematische Sonderhefte, die nicht vom Stamm-Editorial-Board einer Zeitschrift, sondern von Gast-Herausgeber*innen verantwortet werden.
Auch diese Formate können selbstverständlich wertvolle wissenschaftliche Beiträge liefern. Wie sich in den letzten Jahren gezeigt hat, können sie aber auch strukturell ausgenutzt und missbraucht werden. Dieser Missbrauch kann so aussehen, dass es Gast-Herausgeber*innen mit der Qualitätskontrolle nicht so ernst nehmen oder diese ganz gezielt ignorieren. Denn die Verantwortung zur Umsetzung des Begutachtungsverfahrens und die letzte Publikationsentscheidung liegt immer bei den Herausgeber*innen. So können nicht nur Gefälligkeiten im Sinne von Zitations- oder Publikationskartellen unter Bekannten ausgetauscht, sondern auch Geschäfte im großen Stil getätigt werden: Indem man mit sogenannten Paper Mills kollaboriert, und gezielt komplett fabrizierte und anschließend an „Autor:innen“ verkaufte Artikel ohne Qualitätskontrolle in diesen Sonderheften unterbringt.
Eine Analyse von Abalkina (2023) untersuchte Netzwerke verdächtiger Publikationen einer Agentur, die Autor*innenenschaften in wissenschaftlichen Zeitschriften zum Kauf anbietet. Eine Erstautor*innenschaft kostet dabei extra, Zeitschriften mit überdurchschnittlichem JIF sind teurer als unterdurchschnittliche JIF. Bei ihren Recherchen sind Abalkina verdächtige Publikationsnetzwerke auch in verschiedenen Zeitschriften von MDPI aufgefallen.
Aber nicht nur aufgrund dessen geriet MDPI vermehrt in die Kritik. Während Verlage wie Wiley bei seinem Imprint Hindawi oder der Open-Access-Verlag Frontiers hunderte problematische Artikel zurückzogen, ganze Zeitschriften einstellten und die Peer Review-Prozesse überprüften, fällt die Reaktion von MDPI auf die gesamte Problematik scheinbar weniger konsequent aus. Insgesamt scheint MDPI mehr als andere Open-Access-Verlage Gefahr zu laufen, wirtschaftliche Interessen – die Quantität des Outputs – über wissenschaftliche Qualität zu stellen. Dies hat dazu geführt, dass mehrere MDPI-Zeitschriften – darunter Nutrients, Sustainability und Polymers – aus wichtigen Datenbanken wie dem Web of Science und eben dem DOAJ entfernt wurden. Im Falle des DOAJ dürften insbesondere die jüngsten Ausschlüsse seit dem Herbst 2024 auf die überarbeiteten Richtlinien zurückzuführen sein, wonach nur noch 25 % der Artikel in Special Issues erscheinen dürfen. Wird diese Quote überschritten, ist davon auszugehen, dass die Menge an Artikeln in diesen Sonderheften nicht mehr zuverlässig geprüft werden kann. Die Zeitschriften werden aus dem DOAJ ausgeschlossen.
Die DFG empfiehlt das DOAJ als Referenz
Besonders im Fokus der laufenden Debatte
stehen sogenannte Special Issues,
also thematische Sonderhefte,
die nicht vom Stamm-Editorial-Board
einer Zeitschrift, sondern von
Gast-Herausgeber*innen verantwortet werden.
Diese Formate können strukturell
ausgenutzt und missbraucht werden.
Für die Bewertung der Qualität von Open-Access-Zeitschriften orientieren wir uns im Open Science Office an der Universitätsbibliothek Leipzig vorrangig am DOAJ. Das DOAJ gilt als besonders transparent, da es seine Indexierungskriterien klar formuliert und veröffentlicht, und weil es Ausschlüsse ebenso wie Neuaufnahmen in die Datenbank zeitnah öffentlich dokumentiert. Eine Listung im DOAJ ist daher ein verlässlicher Indikator dafür, dass eine Zeitschrift grundlegende Qualitätsstandards einhält. Dieses Vorgehen entspricht auch den Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die Übernahme von Open-Access-Publikationskosten im gleichnamigen Förderprogramm.
Eine Listung im DOAJ
ist ein verlässlicher Indikator dafür,
dass eine Zeitschrift grundlegende
Qualitätsstandards einhält.
Dieses Vorgehen entspricht
den Empfehlungen der DFG
für die Übernahme von
Open-Access-Publikationskosten
im gleichnamigen Förderprogramm.
Falls eine Zeitschrift, für die wir im Open Science Office einen Förderantrag an den Publikationsfonds erhalten, nicht im DOAJ gelistet ist, prüfen wir, ob die Zeitschrift aktiv ausgeschlossen wurde und aus welchem Grund dies geschah. Wurde sie aufgrund von Qualitätskriterien ausgeschlossen, lehnen wir eine Förderung ab. Liegt der Ausschluss hingegen an formalen Kriterien oder wurde die Zeitschrift noch nie indexiert, beispielsweise weil diese erst kürzlich gegründet wurde, prüfen wir alternative Indizes wie die des Web of Science, PubMed oder Scopus.
Bereits bewilligte Anträge bleiben von dieser Regelung unberührt. Sollte es jedoch nachträglich zu einem Ausschluss der Zeitschrift aus dem DOAJ kommen, informieren wir die betroffenen Autor:innen. Das Verfahren kommt zum Einsatz für alle Förderanträge die uns seit dem 1.1.2025 erreichen und bei denen die Beiträge auch erst ab diesem Datum bei der Zeitschrift eingereicht wurden.
Was bedeutet das für Autor*innen?
Wir empfehlen dringend, vor der Einreichung Ihres Open-Access-Artikels die Zeitschrift im DOAJ zu prüfen. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Forschungsergebnisse in einer vertrauenswürdigen Publikation veröffentlicht werden und für eine zentrale Finanzierung qualifiziert sind. Sollten Sie unsicher sein, steht Ihnen das Open Science Office gerne beratend zur Seite.
Wir empfehlen dringend, vor der Einreichung Ihres Open-Access-Artikels die Zeitschrift im DOAJ zu prüfen.
Dr. Astrid Vieler, Ko-Leiterin Bereich Bibliotheken und Service; bis März 2025 Open-Access-Referentin für Medizin und Naturwissenschaften
Mit diesem Vorgehen möchten wir nicht nur die Qualität der geförderten Veröffentlichungen sichern, sondern auch ein klares Signal an Verlage senden: Die Einhaltung wissenschaftlicher Standards und ein zuverlässiges Peer-Review-Verfahren sind nicht verhandelbar.
Neben der Förderung durch den Publikationsfonds können Forschende der Universität Leipzig die Transformationsverträge nutzen. Diese decken die Publikationskosten für Open-Access-Optionen in bestimmten kostenpflichtigen Zeitschriften ab, sowie die Lizenzkosten für den Zugriff auf die nicht-freien Inhalte dieser Zeitschriften. Eine Liste der Verlage und die weiteren Informationen finden Sie auf der Website der UBL.
Für alle Fragen rund um das Open-Access-Publizieren und die Finanzierungsmöglichkeiten wenden Sie sich an openscience@ub.uni-leipzig.de.
Dieser Beitrag erschien zuerst im Leipziger Universitätsmagazin.